Ein Schwimmbad-Betreiber muss 4.500 Euro Vertragsstrafe zahlen, weil er trotz Unterlassungserklärung erneut eine rechtswidrige AGB-Klausel verwendet hat. Das OLG Hamm (Urteil vom 15.04.2025 – Az. 4 U 77/24) entscheidet zur „Kerntheorie“.
I. Gegenstand der Entscheidung – Rechtlicher Hintergrund
Im Zentrum der Entscheidung steht die Frage der Verwirkung einer Vertragsstrafe wegen der Verwendung einer inhaltsgleichen Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Dabei geht es insbesondere um die Reichweite eines vertraglich versprochenen Unterlassungsgebots und die Anwendung der Kerntheorie zur Inhaltsgleichheit von Klauseln im Lichte der §§ 339 BGB, 305c Abs. 2 BGB sowie 307 BGB.
II. Worum ging es genau?
Ein Verbraucherschutzverband (Kläger) nahm ein Schwimmbadunternehmen (Beklagte) auf Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 4.500 € in Anspruch. Anlass war die erneute Verwendung einer AGB-Klausel, die in modifizierter Form im Jahr 2023 in der Haus- und Badeordnung des Schwimmbads verwendet wurde.
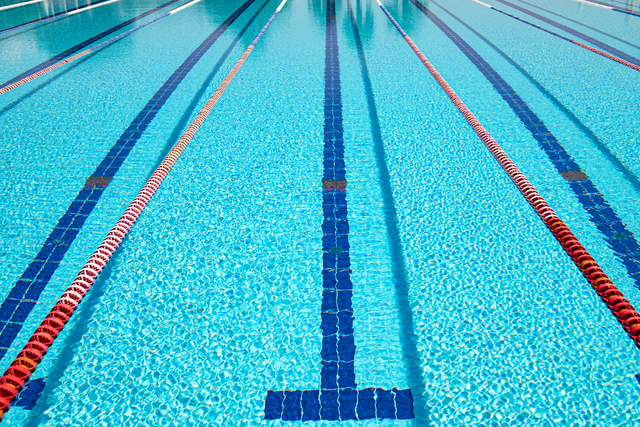
Bereits im Jahr 2017 hatte der Kläger eine fast gleichlautende Klausel abgemahnt und die Beklagte hatte daraufhin eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. Sie verpflichtete sich, die beanstandete sowie inhaltsgleiche Klauseln künftig nicht mehr zu verwenden.
Die nunmehr verwendete Klausel regelte bei Verlust eines sog. „ChipCoins“ eine Sicherheitsleistung von 80 €, die teilweise einbehalten wurde. Der Kläger sah hierin eine Umgehung der Unterlassungsverpflichtung, insbesondere weil die Klausel – wie die ursprünglich abgemahnte – eine verschuldensunabhängige Schadensersatzhaftung begründe.
Das Landgericht Dortmund wies die Klage zunächst ab, da es keine Inhaltsgleichheit zwischen den Klauseln sah. Dagegen legte der Kläger Berufung ein.
III. Rechtliche Erwägungen des OLG Hamm
Das OLG Hamm hob das erstinstanzliche Urteil auf und gab der Klage statt. Die zentralen Erwägungen des Gerichts sind:
1. Zulässigkeit der Berufungsentscheidung trotz Teilurteils
Das OLG konnte trotz eines verfahrensfehlerhaften Teilurteils des LG in der Sache entscheiden, da dies im Interesse der Prozessökonomie sachdienlich sei (§ 538 Abs. 2 Nr. 7 ZPO).
2. Anwendbarkeit der Kerntheorie
Zur Beurteilung der Inhaltsgleichheit zog der Senat die sog. Kerntheorie heran. Danach sind Klauseln dann als inhaltsgleich zu beurteilen, wenn sie den rechtlichen Kern der abgemahnten Verletzungshandlung unberührt lassen. Der Inhalt ist dabei unter Heranziehung der Unwirksamkeitsbegründung aus der Abmahnung zu ermitteln.
3. Bindungswirkung der Unterlassungserklärung
Da sich die Beklagte ohne Einschränkungen zur Unterlassung verpflichtet hatte, wurde vermutet, dass sie alle in der Abmahnung geltend gemachten Unwirksamkeitsgründe – hier u. a. Intransparenz and verschuldensunabhängige Haftung – zukünftig vermeiden wollte.
4. Inhaltsgleichheit der neuen Klausel
Das OLG sah die neue Klausel als inhaltsgleich an, weil:
- sie denselben Anwendungsbereich betrifft (Verlust von Gegenständen im Bad),
- sie eine vergleichbare Rechtsfolge anordnet (Einbehalt einer Leistung/Sanktion ohne Verschulden),
- sie nach § 305c Abs. 2 BGB so auszulegen ist, dass der Badegast selbst bei missbräuchlicher Nutzung durch Dritte für die auf dem Chip verbuchten Beträge haftet,
- sie damit ebenfalls gegen § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB i.V.m. § 280 Abs. 1 BGB verstößt.
Der Umstand, dass die neue Klausel nun klarer formuliert sei und keinen Transparenzverstoß mehr darstelle, sei unerheblich, weil der Kernverstoß (verschuldensunabhängige Haftung) fortbestehe.
5. Verwirkung und Vertragsstrafe
Da ein objektiver Verstoß gegen die Unterlassungserklärung vorlag, wurde das Verschulden der Beklagten vermutet, was sie nicht widerlegen konnte. Die Vertragsstrafe sei daher fällig und in Höhe von 4.500 € gerechtfertigt.
IV. Empfehlung für Unternehmen zum Umgang mit Vertragsstrafen
1. Vertragsstrafeversprechen ernst nehmen: Nach Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung müssen inhaltlich ähnliche Klauseln sehr sorgfältig geprüft werden. Formal geänderte Formulierungen reichen nicht aus, um den Regelungsgehalt so weit zu ändern, dass sie als nicht inhaltsgleich gelten.
2. Kerntheorie beachten: Unternehmer sollten die Rechtsgründe aus früheren Abmahnungen vollständig erfassen und alle Aspekte der beanstandeten Regelung vermeiden, nicht nur einzelne.
3. Transparente und differenzierende AGB verwenden: Klauseln sollten klar formuliert und so gestaltet sein, dass keine verschuldensunabhängige Haftung entsteht. Auch der Anwendungsbereich und die Rechtsfolgen müssen klar voneinander abgegrenzt werden.
4. Regelmäßige rechtliche Überprüfung von AGB: Nach Änderungen im Gesetz oder Rechtsprechung (wie der UKlaG-Novelle) sollten AGB-Klauseln regelmäßig anwaltlich überprüft werden, um Abmahnungen und Vertragsstrafen zu vermeiden.
Fazit
Die Entscheidung des OLG Hamm unterstreicht die hohe Bedeutung von AGB-Kontrolle und Vertragsstrafenmanagement im Wirtschaftsrecht. Unternehmer, insbesondere im Endkundengeschäft, sollten jede AGB-Änderung rechtlich durch AVANTCORE Rechtsanwälte validieren lassen, um wirtschaftliche Risiken zu vermeiden.
